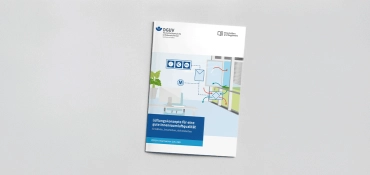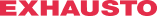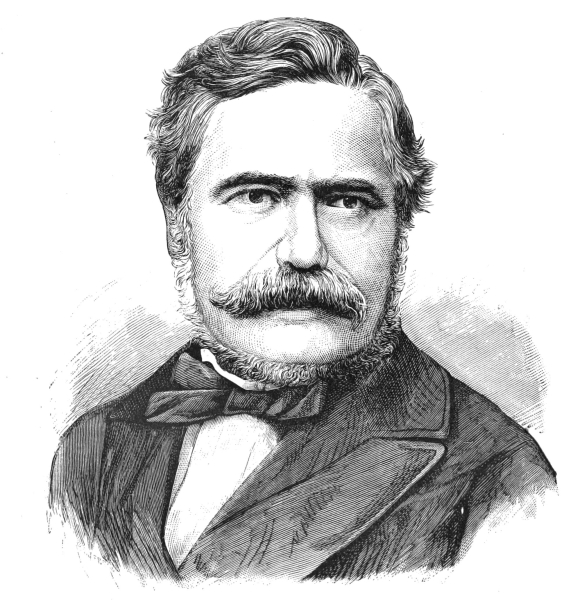Gutes Raumklima - Warum?

Erfahren Sie was für einen Mehrwert Ihnen gesunde Luft bringt und was es Sie kostet, ihr keine Aufmerksamkeit zu schenken.
1.000 ppm CO2 – Der Grenzwert für ein gesundes Raumklima
Bereits im 19. Jahrhundert forschte Prof. Dr. Max von Pettenkofer zu diesem Thema. Als Arzt, Apotheker und Hygieniker untersuchte er unter anderem die Veränderungen der Luftqualität durch die Menschen in geschlossenen Räumen. 1879 gründete er das erstes Hygiene-Institut der Welt in München.
Seine unzähligen Experimente und Untersuchungen ergaben, dass ab einem CO2-Gehalt von 1.000 ppm eine signifikante Verschlechterung der Luftqualität eintritt, was zur Folge hatte, dass es bei den Probanden zu einer erhöhten Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Unwohlsein kam.
Dieser ermittelte Grenzwert von 1.000 ppm, auch Pettenkofer-Wert genannt, gilt heute in den grundlegenden Normen und Regulierungen als maßgeblich.
Grenzwertüberschreitung macht krank
Eine Kohlendioxid-Konzentration über 1.000 ppm verursacht:
- deutliche Zunahme von Symptomen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel und Konzentrationsschwäche
- höheres Ansteckungsrisiko durch eine höhere Keimkonzentration in der Luft
- signifikante Belastungen für die Schleimhaut- und respiratorische Symptome CO2-Anstieg pro 100 ppm
- erhöht die Ausfallzeiten / Fehlzeiten von Mitarbeitern und Schülern
- Verschlechterung des Klassen- / Büroklimas
- Anstieg der relativen Abwesenheitsrate von 10–20 %
Quellen der Luftverschmutzung in den Innenräumen
Fensterlüftung allein reicht nicht
Die Fachleute sind sich einig: Für eine gesunde, lern- und leistungsfördernde Innenraumluftqualität während der Arbeit und des Unterrichts reicht eine Lüftung über Fenster allein nicht aus.
Umweltbundesamt
- Die Anforderungen an Arbeits- bzw. übliche Aufenthaltsräume können allein mittels Fensterlüftung oder lediglich mit mechanischen Abluftanlagen bei winterlichen Außentemperaturen in der Regel nicht erreicht werden.
- Eine Lüftung über Fenster allein zum Erreichen einer guten Innenraumluftqualität während des Unterrichts in Schulgebäuden ist nicht ausreichend.
VDI 6040
Die freie Fensterlüftung stößt bei Raumhöhen unter 3,5 m und Belegungsdichten von ≤ 2 ,5 m ²/Person … an ihre natürlichen Grenzen.
AMEV- RLT-Anlagenbau 2023
Ohne Störung des Unterrichts oder Einschränkungen bei der Klassenbelegung ist die freie Lüftung kaum möglich. Insofern ist die ausreichend dimensionierte bedarfsgeregelte maschinelle Be- und Entlüftung für Schulräume zur Sicherung eines hygienischen Mindestaußenluftwechsels zu empfehlen.
Fazit
Eine gute mechanische Be- und Entlüftungsanlage sorgt für...
- ein optimiertes CO2-Niveau
- max. mögliche Filtrierung von Pollen und Feinstaub aus der Außenluft
- ein besseres Schallniveau, da die Fenster geschlossen bleiben
- thermische Behaglichkeit
- energetische Einsparung aufgrund der WRG
- ein gesundes Raumklima, Arbeits- und Lernumfeld für Mitarbeiter, Schüler und Lehrkräfte.

Weiterführende Links
Lüftungskonzepte für eine gute Innenraumluftqualität
Im Mai 2025 hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) eine neue Informationsschrift veröffentlicht: Die DGUV-Information 215-550 gibt praxisnahe Hinweise für Lüftungskonzepte zur Sicherstellung einer guten Raumluftqualität.
Mehr erfahren